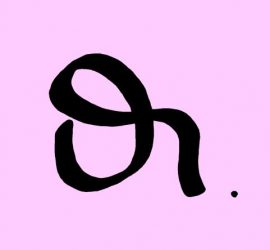Ich freue mich auf einen richtigen Strandtag! Es ist fast windstill, und die Sonne scheint auf das unendlich weite Watt. Die ganze erste Urlaubswoche ist kalt, regnerisch und ungemütlich gewesen, so dass ich mittlerweile alle Geschäfte und die meisten Cafés der Insel kennen gelernt habe. Dabei wollte ich mich doch in purer Natur erholen. Nun gut, heute ist es soweit! Nur Strand, Watt, Himmel und Meer. Und ich.
Auf der Bank vor der roten Holzhütte der Strandkorbvermietung sitzt ein alter Mann im blauen Fischerhemd. Er trägt eine dunkle Mütze und nagt an einer Pfeife. Ich nicke ihm freundlich zu, doch er verzieht nur das Gesicht. Ich ernte lediglich ein knappes „Moin.“ Manchmal glaube ich, diese Insulaner gönnen uns Touristen den Strand nicht. Am liebsten wären sie wohl unter sich.
Ich ziehe meine Schuhe aus und stecke sie in den Rucksack. Bei jedem Schritt spüre ich den feinen Sand zwischen meinen Zehen rieseln. Ich laufe. Immer geradeaus. Herrlich! Erst durch weichen weißen Sand, dann über festes graubraunes Watt dem Meeressaum entgegen. Völlig außer Atem bleibe ich stehen.
Ich sehe eine scharfe Linie, dort wo der wolkenlose Himmel auf das glitzernde Meer trifft. Wie kleine schwarze Brocken unterbrechen die Halligen den fernen Horizont, aufgereiht zu einer Perlenkette. Ich breite meine Arme aus, drehe mich um mich selbst und spüre, wie die salzige Luft auf meiner Haut prickelt. Weit entfernt höre ich die Geräusche der Insel und das Kreischen der Möwen. Was für ein wunderbarer Tag!
Neben einem kleinen Priel setze ich mich auf den Boden, packe mein Fischbrötchen aus und beiße genüsslich hinein. Nirgendwo schmeckt das besser! Ich schaue mir den Grund des Priels genauer an. Im klaren Wasser tummeln sich Krebse, Muscheln und kleine Krabben, die vom Wasserstrom langsam fortgetragen werden. Je länger ich schaue, desto mehr entdecke ich. Ein großes Schneckenhaus bewegt sich plötzlich, und ich sehe, dass die Scheren eines Krebses herausragen. Ein Einsiedlerkrebs?
Mein Sitzplatz wird langsam feucht, und die Sonne hat an Kraft verloren. Mir wird kalt. Ich stehe auf, packe meinen Rucksack und wende mich in Richtung Meer. Die scharfe Linie des Horizonts hat sich in einen milchig grauen Schleier verwandelt. Auch die Halligen sind nur noch als dunkle Schatten erkennbar. Das ging wirklich schnell!
Ich drehe mich um und traue meinen Augen nicht. Der Strand ist kaum zu erkennen, alles versinkt im Nebel. Wie kann das sein? Der kleine Priel ist nun schon mehr als einen Meter breit. Sein Wasser strömt schnell der Insel entgegen. Die Flut kommt! Ich muss zurück. Ans Ufer. Schnell.
Auf der Suche nach einer schmalen Stelle renne ich den Priel entlang, springe über kleinere Verzweigungen und versuche gleichzeitig, den Strand nicht aus den Augen zu verlieren. Dann endlich finde ich eine geeignete Stelle, springe hinüber und laufe weiter. Der Nebel wird immer dichter, und ich höre nun keine Geräusche mehr. Kein Meeresrauschen, keinen Möwenschrei. Alles ist grau und dumpf. Mein Herz klopft und dröhnt in meinen Ohren. Meine Gedanken rasen und ich zittere vor Aufregung. Sturmflutbilder erscheinen in meinem Kopf.
Der nächste Priel versperrt mir den Weg. Ich springe erneut und wende mich dahin, wo ich das Ufer vermute. Das Watt wird weicher, meine Füße sinken immer tiefer in den Schlick. Ich komme nur noch mühsam voran. „Hilfe!“ Tränen laufen über mein Gesicht. „Hilfe!“ Was soll ich nur tun?
Wie aus dem Nichts taucht ein dunkler Schatten auf. Fast wäre ich in ihn hineingerannt. Mitten im Watt steht der alte Mann in seinem blauen Fischerhemd. Er sieht mich grimmig an, sagt aber kein Wort. Er dreht sich um und macht mit der Hand ein Zeichen, dass ich ihm folgen soll. Dankbar und noch immer zitternd wanke ich hinter ihm her. Es dauert nur wenige Minuten, dann erscheint zwischen Nebelschwaden der Umriss der roten Holzhütte. Ich atme auf. Geschafft.
Der alte Mann schlurft zu seiner Bank und setzt sich ächzend. Er hebt die Hand und zeigt mit dem Finger auf mich. „Deern. Dat is Säi-Näibel! Dat is bannich gefährlich!“, grummelt er und wedelt dann mit der Hand in meine Richtung, als würde er einen Fliegenschwarm vertreiben wollen. Er greift in die Tasche, zieht die Pfeife heraus und blickt in Richtung Meer.
Mein atemloses „Dankeschön!“ hat er wahrscheinlich nicht gehört.